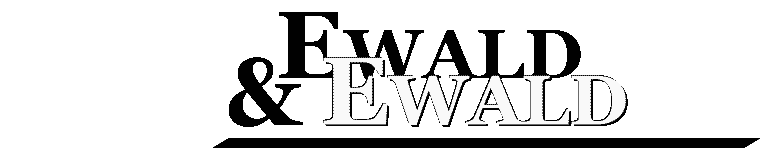Wilfried Hasselberg-Weyandt
Miscellanea Gregoriana
I. Das Canticum «Benedicite»
Längere Einleitung: Sein österlicher Charakter
Der «Tonus peregrinus», so weiß man seit letztem Jahr
1, hat in Synagoge und (römischer) Kirche paschalen Charakter. Er ist in der Kirche vor allem dem Psalm «In exitu» gewidmet, in der II. Sonntagsvesper; zudem erscheint er noch bei der Antiphon «Angeli/Martyres Domini * Dominum benedicite in æternum» von St. Michaël und aus dem Commune mehrerer Märtyrer.
In der Vesper ist diese Antiphon verbunden mit dem 4. Vesperpsalm, «Laudate pueri»; allerdings gehört er nicht nur zur Vesper, sondern auch zu den Laudes. Wo aber dieselben Antiphonen für ein Fest in einer der beiden Vespern und in den Laudes erscheinen, ist nach durchgängigem Zeugnis alter Antiphonarien ihr ursprünglicher Ort der in den Laudes (schon die Lecture des Corpus Antiphonalium Officii zeigt das deutlich). Aber auch der Text der Antiphon entspricht dem Canticum, das in den Laudes die Stelle des 4. Psalms einnimmt: dem Benedicite, dem Canticum der drei Jünglinge (Dan. 3, 57-88).
Das aber bestätigt den österlichen Charakter dieses Psalmtons, denn dieses Canticum gehört zumindest seit dem IV. Jahrhundert zur christlichen Osterfeier (dabei schwankt nur die Abgrenzung dieses Canticum).
Im ältesten Text für die Osternacht, dem Altarmenischen Lektionar aus dem V. Jahrhundert, das den Jerusalemer Brauch des IV. wiedergibt, bildet es, mit dem einleitenden Daniel-Text, den Abschluß der Vigillesungen. In Rom hat sich an dieser Stelle die Lesung aus Daniel 3 erhalten: die Verse 1-24; das Canticum könnte hieran unmittelbar anschließen. Der Schwesterritus des römischen aber, der beneventanische, hat an dieser Stelle das Canticum samt des einleitenden Daniel-Textes; in unserem Ritus steht es hier am Quatembersamstag (hier allerdings nicht das «Benedicite», sondern die vorangehenden Verse 52-56 des Canticum, welche mit «Benedictus» beginnen).
— Exkurs: Das Morgenevangelium
Des Sonntagmorgens, so berichtet die Pilgerin Eucheria (oder «Egeria» oder «Aetheria») um die Wende des IV. Jahrhunderts aus Jerusalem, liest der Bischof in der Auferstehungskappelle, nachdem drei Psalmen gesungen worden sind, ein Auferstehungsevangelium
2. Dann zieht eine Prozession mit Gesang in die Basilika, wo ein weiterer Psalm gesungen wird und die Feier mit Gebet und bischöflichem Segen schließt.
Dieses sonntagmorgendliche Auferstehungsevangelium erscheint noch heute im byzantinischen und armenischen Ritus. Der römische Ritus kennt es nicht; aber die Regel Benedikts beschließt die Sonntagsvigilien mit einem Morgenevangelium
3, seit dem Mittelalter mit der Perikope der Sonntagsmesse.
Das alles ist dank Juan Mateos wohlbekannt; zu ergänzen ist aber noch, daß im römischen Ritus, der im Altertum und Frühmittelalter keineswegs einheitlich war, ein solches Morgenevangelium in zwei weiteren Ausbildungen bezeugt ist:
Als Morgenevangelium erscheint in den monastischen Vigilien – bei den Kartäusern bis heute – zu Weihnachten und Epiphanie je eine der Genealogien des Herrn, zu Epiphanie die aus Lucas, verbunden mit dem Bericht von der Taufe im Jordan. Diese beiden Morgenevangelien haben eigene Gesangsweisen, deren eine mit einem auch textlich vergleichbaren Synagogengesang übereinstimmt
4. Sie fanden sich zu Weihnachten und Epiphanie im Mittelalter aber auch in der nichtmonastischen römischen Matutin fast überall – nur nicht in Rom selbst.
Während Benedikt jedoch das Evangelium ans «Te Deum» anschließt und ihm «Te decet laus» folgen läßt, steht es in der nichtmonastischen Matutin nach dem letzten Responsorium der vorangehenden Nokturn, vorm «Te Deum» – so wie in karolingischer Zeit schon im Ordo Romanus XVI, der sich hierbei zu unrecht auf Benedikt beruft.
Schließlich ordnete unter Gregor III. eine römische Synode 732 an, daß die drei Basilikalklöster von S. Peter an allen Tagen drei Psalmen und «Evangelia matutina» sängen
5. Daß «Evangelia matutina» hier ohne weitere Erklärung genannt werden und auch die drei Psalmen nicht näher bezeichnet zu werden brauchen, zeigt, daß im Rom des frühen 8. Jahrhunderts ein solches Officium nicht unbekannt war. Daß hier die «Evangelia matutina» allerdings gleich nach der Vesper angeordnet wurden, kann nicht ursprünglich sein.
— Rekurs: Das Canticum
Dem Morgenevangelium gehen im armenischen Ritus drei alttestamentliche Cantica voran. Ebenso geht ihm in der Regel Benedikts eine Nokturn voraus, in der drei solche Cantica an die Stelle der Psalmen treten. Drei alttestamentliche Cantica stehen an dieser Stelle auch im assyrisch-chaldäischen wie im ambrosianischen Ritus, auch wenn ihnen das Morgenevangelium selbst fehlt.
Daher dürften schon die «drei Psalmen» Eucherias alttestamentliche Cantica gewesen sein; weder im Altertum noch im Mittelalter wurden Psalmen und Cantica terminologisch streng unterschieden. Zu diesen Cantica gehört im armenischen Ritus auch das der drei Jünglinge. Nicht an dieser Stelle, aber gleich danach in die Laudes des Sonntagmorgens, erscheint es im ambrosianischen und im römischen Ritus. Der byzantinische, der maronitische und der æthiopische Ritus schließlich haben es hier täglich (täglich hat es heute auch der armenische).
Hat das Benedicite also zu jenen drei «Psalmen» gehört? Ich bezweifle das; denn der assyrisch-chaldäische, der ambrosianische und der benediktinische Ritus kennen drei Cantica, aber das Benedicite gehört nicht dazu, sondern folgt bald danach. Das aber ist leicht erklärlich, wenn man im Benedicite jenen «Psalm» erkennt, der nach dem Morgenevangelium in der Basilika gesungen wurde – dieser konnte leicht zu den darauf folgenden Laudes gestellt werden
6.
Ein Rätsel – oder doch keines? –:
Woher eigentlich kommt das Canticum?
α) Seine Bezeugung in der Schrift
Wer das Canticum der drei Jünglinge in der Biblia Hebraïca sucht – die in diesem Teil eine Biblia Aramaïca ist –, wird enttäuscht: in Dan. 3 folgt auf Vs. 23 gleich Vs. 91, um der Undeutlichkeit willen mit «24» numeriert. Und Hieronymus schreibt an dieser Stelle, daß er jenes Stück in den hebräischen Schriftrollen nicht gefunden, darum aus Theodotions Ausgabe übersetzt habe.
Daß das fehlende Stück zum genuinen Bestand des Buches Daniel gehört, war von der katholischen Theologie kaum in Frage gestellt worden. Da aber auf protestantischer Seite par ordre du réformateur allen Teilen des Alten Testaments, die nicht in der hebräischen Bibel rabbinischer Überlieferung stehen, der Charakter Heiliger Schrift aberkannt wurde (auch dem Buch Sirach, das sich nicht dort, wohl aber in der hebräischen Bibelüberlieferung der Qaräer findet), sahen protestantische Theologen sich veranlaßt, einfachheitshalber diesen Teil des Buches Daniel als nachträglich eingeschoben zu betrachten.
Das erforderte einen Beweis für die Ursprünglichkeit des Stückes, der allerdings leicht zu führen ist:
1. Die schlichte Lecture des gekürzten Textes zeigt, daß etwas fehlt: Nabuchodonosor (oder Nabuchadnesar oder Nªbuchadnessar) entsetzt sich ohne Grund; erst später erfährt man, was er gesehen hat, noch später, daß er recht gesehen hat. In moderner Litteratur
7 dürfte man das unter «Stilmittel» rubrizieren; aber im Alten Testament? Es fehlt die Erzählung, was geschehen ist; es fehlt darüber hinaus das Innehalten: die drei fallen in den Feuerofen, und sogleich ist der König entsetzt, bevor der Erzählfluß Gelegenheit gibt für etwas, was ihn entsetzen könnte. Biblischer Erzählstil ist das nicht. Erst recht kein biblischer Erzählstil ist es, daß man vom Eingreifen des Engels nur aus dem Munde Nabuchodonosors erfährt. In der Septuaginta und Vulgata dagegen liest sich das Stück ohne Schwierigkeit.
2. Für das Buch Daniel gibt es zwei griechische Textüberlieferungen, von denen die eine wohl zur eigentlichen Septuaginta gehört, die andere, jüngere, später allein gebräuchliche, nach der Angabe des Hieronymus die des Theodotion ist. Diese Übertragungen sind beide jüdischer Herkunft. Sie gehen beide auf verschiedene Varianten eines grosso modo übereinstimmenden Grundtextes zurück; dem überlieferten hebräischen Text steht Theodotions Version viel näher als die ältere Septuaginta, deckt sich jedoch nicht völlig mit ihr (3, 22!).
Auch in den Stücken, die im aramäischen Text fehlen, liegen beide Übersetzungen vor, mit dem gewohnten Maß an Abweichungen untereinander. Wenn nun beide Übersetzungen diesen Text einschließen in ihre Daniel-Übersetzung, dann muß auch der zu übersetzende Grundtext an dieser Stelle im hebräisch-aramäischen Buch Daniel gestanden haben.
Diese einfache Argumentation ist nirgendwo widerlegt worden. Hingewiesen wird darauf, daß das Gebet des Azarias (3, 26-45) nachträglich eingefügt sein könnte: bereits Vs. 24 läßt sich am einfachsten als Einleitung des Gesangs der drei Jünglinge (der Vss. 52 ff. also) verstehen. Damit ist freilich nur gezeigt, daß der überlieferte Text eine Vorgeschichte hat; man kann jedoch nicht jene Doppelung beseitigen, indem man zusammen mit dem Gebet des Azarias die Vss. 46-51 streicht – das scheitert wieder an den beiden genannten Argumenten. Und der Gesang der drei Jünglinge selbst ist von dieser Erwägung gar nicht betroffen.
Die andere Doppelung des Vulgatatextes, daß nämlich die umstehenden Chaldäer in Vs. 22 und noch einmal in Vs. 48 verbrennen, ist künstlich: Hieronymus hat Vs. 22 nach dem aramäischen Text übersetzt, Vs. 48 aber, welcher ja im aramäischen Text fehlt, nach Theodotion. Diese Szene nun erscheint im aramäischen Text bereits in Vs. 22, bei Theodotion jedoch erst in Vs. 48. Doppelt hat diese Szene allerdings auch der Septuaginta-Text (Vs. 23/48).
Doch dann machten sich katholische Theologen daran, die Behauptung, dieses Stück gehöre nicht zum ursprünglichen Daniel-Text, durch stete Wiederholung immer wahrer zu machen. Bereits anno 1949 erklärt in «Biblica» unter tiaragekröntem Signet Oden-Schneider (S. 440), es seien keine Anzeichen dafür vorhanden, daß Theodotion für die Oden eine semitische Vorlage benutzt habe. Dementsprechend geben katholische Bibelausgaben wie die Einheitsübersetzung vor, diese Texte seien von vornherein in Griechisch abgefaßt gewesen.
Schneiders Argument ist methodisch abwegig. Zwar ist in den Cantica der Unterschied der beiden griechischen Fassungen so mäßig, daß Theodotions Text für eine Emendation von Septuaginta-Varianten gehalten werden könnte; doch die Textunterschiede in den Vss. 24-25, 46-51 sind viel zu groß für solch eine Erklärung: hier muß Theodotion einen aramäischen Text übersetzt haben. Diese Textpartien aber sind nicht unabhängig von den Cantica denkbar. Sollte Theodotion für die überleitenden Verse den aramäischen Text benutzt haben, nicht aber für die damit verbundenen Cantica?
Zudem: Theodotion hat für den jüdischen Gebrauch eine dem hebräisch-aramäischen Grundtext nähere griechische Übersetzung der Schrift ausgearbeitet – wozu hätte er Textpassagen aufnehmen sollen, die gar nicht zu diesem Grundtext gehörten?
Das ganze Stück, die Vss. 24-90, war also aramäisch abgefaßt; und diese Fassung hat Theodotion noch gekannt.
Warum diese Passagen in der jüdischen Überlieferung beiseite gelassen wurden, ist natürlich nicht mehr zu klären. Aber der Rang dieser Texte für Juden und für Christen ist sehr verschieden: für Christen ist Daniel ein Prophet (Matth. 24, 15); und die Rettung der drei Jünglinge ist ein Antitypos der Auferstehung des Herrn. Dieser Aspekt aber ist den Juden fremd; und das Buch Daniel gilt ihnen nur als Hagiograph.
β) Der aramäische Text des Canticum
Wer nun allerdings versucht, den aramäischen Text aus dem griechischen zu rekonstruieren, stößt zunächst in den Vss. 52-56 des Canticum auf grundsätzliche Schwierigkeiten: die Vielfalt der Lobpreis-Vokabeln läßt die aramäischen Äquivalente nicht erkennen.
Für «gelobt» steht teils «ainetós», teils «hymnetós». «Aineîn» ist sicher «schabbah». «Hymnetós» könnte der Hebraïsmus «hallel» sein; da jedoch in der Septuaginta für «thªhilla» «aínesis» und «hýmnos» durchaus als Synonyme behandelt werden
8, könnten auch hier beide synonym «schabbah» wiedergeben. Diesen Worten ist, ebenso wie dem «verherrlichen», oft ein «hyper-» vorangesetzt. Die Verwendung dieses «hyper-» aber ist so unbeständig, wenn man die beiden griechischen Übersetzungen und zudem den griechischen Text im Buch der Oden vergleicht, daß man hierin einfach ein Spiel der Übersetzer sehen darf, ohne Grundlage im aramäischen Text – der Anlaß dafür war das «hyper-» in «hyperypsoûn», der hier verwendeten Übersetzung des Begriffs «erheben».
Nicht jedoch als Übersetzungsfreiheit einordnen läßt sich das Nebeneinander von «loben» und «verherrlichen», denn «doxázein – verherrlichen» steht im Griechischen des Neuen Testaments ebenfalls für «schabbah», und in den Vss. 26, 53 und 56 stehen diese Wörter beieinander. Die aramäische Grundlage für «verherrlichen» ist nur dem aramäischen Text selbst zu entnehmen.
Der nun ist an dieser Stelle verlorengegangen; Gott sei Dank aber werden seine stehenden Begriffe an anderer Stelle zitiert, und zwar im Daniel-Text der Biblia Hebraïca und bei Theodotion. In 4, 31/34 sagt Nabuchodonosor: «Den Höchsten pries ich; und den ewig Lebenden lobte und verherrlichte ich» – mit demselben Gegenüber von «preisen (= segnen)» und «loben und verherrlichen» wie in 3, 26 sowie (wenn man «aineîn» und «hymneîn» gleichsetzt) in 53 und 56. Der noch fehlende dritte Begriff aus den zweiten Vershälften des Canticum, «erheben», wird zitiert in 4, 34/37: «Ich lobe und erhebe und verherrliche». «Verherrlichen» ist das im übrigen seltene hebräisch-aramäische Verbum «haddar»
9.
Diese Zitate gehören nicht zum allen Textüberlieferungen gemeinsamen Grundtext (auch nicht das dritte Vorkommen von «haddar» im aramäischen AT-Text, Dan. 5, 23, das ebenfalls vom Canticum inspiriert sein mag) – die Septuaginta kennt sie nicht, hat hier eine deutlich andere Textfassung. Keinesfalls kann daher das Canticum die Worte Nabuchodonosors zitieren; die Begriffszusammenstellung ist aber so charakteristisch, daß diese Übereinstimmungen nicht als Zufall abgetan werden können.
So liefert die Suche nach dem aramäischen Text des Canticum unverhofft ein neues zwingendes Argument für die Ursprünglichkeit dieses Textes:
3. In der Variante des Daniel-Textes, die die heutige Biblia Hebraïca bietet, hat sich ein Zitat aus dem Canticum erhalten.
Litteratur:
A. A. Häußling: Mönchskonvent und Eucharistiefeier. Münster 1973 • J. Ledogar: Acknowledgment: Praise verbs in the early Greek anaphora. Roma 1968 • J. Mateos: La vigile cathédrale chez Egérie. Or. Chr. Per. 27, 1961, 286-312 • J. Mateos: Lelya – Sapra. Les offices chaldéens de la nuit et du matin. OCA. 156, 2me édition, Roma 1959 • A. Rahlfs: Septuaginta. Stuttgart 1935 • H. Schneider: Die biblischen Oden in Jerusalem und Konstantinopel. Biblica 30 (1949) 433-452 • P. Wagner: Einführung in die gregorianischen Melodien. I: Ursprung und Entwicklung der gregorianischen Gesangsformen. Leipzig 1911, Hildesheim 1962; II: Neumenkunde. Leipzig 1912, Hildesheim 1962; III. Gregorianische Formenlehre. Leipzig 1921, Hildesheim 1970 • E. Werner: The sacred bridge. New York 1959
1 Th. Baumann: Prolegomena zu einer altisraëlischen Musikgeschichte; E&E 4 (1999).
2 24, 8-11. Mateos: La vigile cathédrale chez Egérie 286-312.
3 RB. 11. Vgl. Mateos 305 ff..
4 Wagner III, 251 ff.; Werner I, 499.
6 Daß auch sonntags Eucheria Laudes kannte, ist unter 27, 2 zu sehen. Im assyrisch-chaldäischen Ritus folgt allerdings am Ostersonntag ein Morgenevangelium dem Benedicite – nach den eigentlichen Laudes-Psalmen, gleich vorm Gloria in excelsis (Lelya – Sapra 76): ursprünglich sein kann das nicht!
7 Etymologisch (wohl-)begründete E&E-Orthographie!
9 Vokalisation nach Dan. 4, 34 – so wie auch im Syrischen.
• Orietur Occidens •
Wilfried Hasselberg-Weyandt
ACHT
oder:
Warum das Taufbecken achteckig
und der Samstag Maria geweiht ist
Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden – so steht es in den Evangelien (Mc. 16, 2. 9; Lc. 24, 1; Joh. 20, 1). Aber dieser Tag war zugleich der achte Tag als Abschluß der Woche, die Er in Jerusalem verbrachte: mit dem achten Tag wird aus der Woche des Verrats und Leidens die Zeit des Heils. Der Auferstehungstag wird darum bald nicht mehr «erster Tag» genannt, sondern «Herrentag» (Apoc. 1, 10) – so wie bis heute im Griechischen, im Lateinischen und in den romanischen Sprachen.
Der achte Tag als Tag des Heils – das ist schon im Alten Testament angelegt: Die Beschneidung, die Aufnahme in den Bund, geschah am achten Tag (Gen 17, 12; Lev. 12, 3) – und ausdrücklich wird gesagt, daß Isaak (Gen. 21, 4), Johannes (Lc. 1, 59), Paulus (Ph. 3, 5) und vor allem Christus selbst (Lc. 2, 21) am achten Tag beschnitten wurden. Am achten Tag wird, wer unrein war, mit einem Opfer für rein erklärt (Lev. 14, 10; 15, 14. 29; Num. 6, 10).
Das Erntedankfest, mit dem sich der Festkreis des Gesetzes vollendet, das Laubhüttenfest, wird mit der Feier des achten Tages beschlossen (Lev. 23, 36. 39; Num. 29, 35). An diesem Tag wird der Tempel geweiht (II. Chr. 7, 9), der für ein Jahrtausend die Mitte der Heilsgeschichte ist. Die neuerliche Weihe des geschändeten Tempels wird acht Tage lang gefeiert; und ebensolang soll jährlich das Gedenken dieses Ereignisses gefeiert werden (I. Makk. 4, 56. 59) – Hanukka, ein Fest, das auch Christus in Jerusalem beging (Joh. 10, 22).
Die alte Kirche wußte die Heilsgeschichte typologisch zu deuten: so wie verschiedene Münzen, von einem Prägestempel geschlagen, das gleiche Gepräge zeigen, den gleichen Typos, so zeigen auch verschiedene Ereignisse der Heilsgeschichte den gleichen Typos, gleichsam als Handzeichen dessen, von dem das Heil kommt. Schon im Neuen Testament sind dafür die Begriffe «typos» und «antitypos» zu finden.
Darum ist es bedeutsam, daß sich so oft Heil mit dem achten Tag verbindet. Und darum ist es sinnvoll, weiter in der Schrift zu forschen, wo die «Acht» als Zahl des Heils zu finden ist.
Im achten Jahr seiner Krankheit wird Aeneas von seiner Lähmung geheilt (Act. 9, 33).
Als dreimal acht kann man die Zahl der Priester deuten, die auf Thronen rund um Gottes Thron sitzen (Apoc. 4, 4).
David, dem verheißen worden ist, Stammvater Christi zu sein, ist der achte Sohn Jessais (I. Sam. 17, 12. 14).
Acht Seligpreisungen sind es in der Bergpredigt (Matth. 5, 3-10).
Und dort, wo Petrus die Taufe als «antitypon» der Arche Noë bezeichnet (I. P. 3, 20 f.), nennt er die Zahl derer, deren Seelen in der Arche gerettet wurden: acht. Und er sagt, daß Noë als achter von ihnen der Verkünder der Gerechtigkeit war (II. P. 2, 5).
Aber nicht nur deshalb ist die Acht die Symbolzahl der Taufe: die Taufe ist das Sakrament der Auferstehung, des achten Tages also.
Freilich ist die Taufe auch das Sakrament des Begräbnisses Christi (Col. 2, 12); ebenso aber ist die «Befragung des guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Christi, der zur Rechten Gottes ist» (I. P. 3, 21 f.). Auferstanden ist der Christ «durch den Glauben an das Wirken Gottes, der Ihn [Christus] auferweckt hat von den Toten» (Col. ebd.). Die Taufe aber ist der Beginn des Glaubens. Darum heißt bis heute der Teil der Liturgie, der in der Urkirche den Katechumenen verschlossen war, «Missa fidelium – Messe der Gläubigen». Und vor der liturgischen Katabasis des späten XX. Jahrhunderts fragte der Priester den Täufling zuerst: «Was begehrst du von der Kirche Gottes?» und erwartete die Antwort: «Den Glauben». Die Acht nun ist auch die Symbolzahl des Glaubens: am achten Tag der Auferstehung findet Thomas den Glauben an sie (Joh. 20, 26).
Darum sind Baptisterien und Taufbecken achteckig.
«Das Heil kommt von den Juden» (Joh. 4, 23). Der Neue Bund geht aus dem Alten hervor; denn Christus, der Heiland des Neuen Bundes, ist der vom Alten verkündigte Messias (von Deut. 18, 15 an). Er ist geboren aus dem Volk des Alten Bundes, von einer jüdischen Mutter, Maria. Und Maria hört die Verheißung des Alten Bundes: «Geben wird ihm Gott, der Herr, den Thron seines Vaters David; und er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit» (Lc. 1, 32 f.). Und so steht Maria am Schluß des Alten Bundes; so, wie der Neue Bund, der Bund Christi, aus dem Alten hervorgeht, so geht Er selbst aus Maria hervor.
Freilich hat Maria Anteil am Neuen Bund, sogar als erste, vom Beginn ihres Lebens an – das lehrt uns das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis. Und sie ist bei den Aposteln bis zum Pfingstereignis (Act. 1, 14). Aber in der weiteren Geschichte der Kirche spielt sie keinerlei Rolle mehr – ihre Tat in der Heilsgeschichte ist ihr «Ja» zu jener alttestamentlichen Verheißung in den letzten Tagen des Alten Bundes.
Der Sabbat aber ist der Tag des Alten Bundes, der die Woche beschließt und als Feiertag vollendet, so wie Maria den Alten Bund beschließt. Mehr noch: die letzte Heilstat im Alten Bund ist die Sabbatruhe, die Christus vor seiner Auferstehung im Grabe einhält. So wie der Neue Bund aus dem Alten hervorgeht, wie der achte Tag, der Tag Christi, aus dem siebten, dem Sabbat, hervorgeht, wie das entscheidende Heilsereignis des Neuen Bundes, die Auferstehung, aus der Sabbatruhe des Alten hervorgeht, so geht Christus aus Maria hervor. So ist der Sabbat also «antitypos» Marias.
Und wie die neue Geburt «aus Wasser und Geist» (Joh. 3, 5) mit der Auferstehung durch den Glauben in der einen Taufe (Eph. 4, 5) zu einem Sakrament verbunden ist, so ist die Geburt Christi aus Maria mit Seiner Auferstehung aus der Sabbatruhe zu dem einen Heilsgeschehen des Neuen Bundes verbunden.
Darum feiert die lateinische Kirche den Sabbat als den Tag Marias.
• Orietur Occidens •
Wilfried Hasselberg-Weyandt
Streifzüge durch die Bibel
Priester
Das Wort «Priester» kommt vom griechischen «presbýteros – Älterer». Dem Volk Israël stand ein Senat von siebzig (Ex. 24, 1. 9; Num. 11, 16; Ez. 8, 11) solcher Älterer vor. Im Neuen Testament werden sie einfach «hoi presbýteroi» genannt, was mit «seniores – die Ältesten» übersetzt wird.
Dementsprechend hat Jesus nächst den Aposteln eine besondere Schar von siebzig oder auch zweiundsiebzig Jüngern berufen (Lc. 10, 1. 17). In der Apostelgeschichte und den Briefen werden dann auch «presbýteroi» der Kirche genannt. In dieser Verwendung wird dieses Wort in der Vulgata gern als Fremdwort – «presbyteri» – beibehalten (Act. 14, 23; 15, 2; I. Tim. 5, 17. 19; Tit. 1, 5); im Deutschen kann man also nun «Priester» sagen.
Aber in deutschen Übersetzungen wird das Wort «Priester» auch für ein ganz anderes Wort benutzt: für die «kohanim – hiereîs – sacerdotes» – Opferdiener, insbesondere die Söhne Aarons, die den Opferdienst am Altar des Tempels leisteten.
Christliche «hiereîs – sacerdotes» aber nennt das Neue Testament nicht; nur Christus selbst wird im Hebräerbrief oft als «archiereús – pontifex», als Hoher «Priester», bezeichnet.
Sicher ist Christus der eigentliche «Hohe Priester», der Kohen haggadol, des Neuen Bundes. Aber: schließlich haben die Christen ein
«thysiastérion» (Hebr. 13, 10), einen Altar, an dem sie sonntags – «katà kyriakén» – die
«thysía», das Opfer, darbringen (Did. 14, 1 f.
1).
Wer macht die Arbeit? Wer sind die Kohanim des Neuen Bundes, die an diesem Altar Dienst tun?
Antwort gibt die Apokalypse: am Sonntag – «en tê kyriakê heméra» (1, 10) – sieht Johannes ein Lamm stehen, «gleichwie geschlachtet», inmitten von vierundzwanzig Priestern – «presbytéron» (5, 6). Warum vierundzwanzig? warum nicht siebzig, wie es sich für «presbytérous» gehört?
Vierundzwanzig ist die Zahl der K’hunna, des alttestamentlichen «Priestertums», genau gesagt: der «Häupter der Vaterhäuser» der Söhne Aarons (I. Chr. 24, 4-19; vgl. Lc. 1, 5), der Oberhäupter der Familien der Kohanim also.
Durch Zahlentypologie, die in der Apokalypse von besonders großer Bedeutung ist, setzt Johannes die christlichen Priester – «presbytérous» – den alttestamentlichen Kohanim gleich.
Die frühe Kirche lehnte den Gebrauch von Weihrauch im Gottesdienst ab, vor allem, weil er in den Zeiten der Christenverfolgung verbunden war mit dem erzwungenen Opfer vor dem Bild des Kaisers. Vom Codex Theodosianus (438) wurde er untersagt, so wie überhaupt alle Opfer (außer, natürlich, der Eucharistie).
Ein Verbot ist in der Regel ein Zeichen dafür, daß das, was verboten wird, durchaus praktiziert wird. Und bald danach verbreitete sich der gottesdienstliche Gebrauch des Weihrauchs in der ganzen Christenheit.
Das theodosianische Verbot setzt voraus, daß Weihrauchgebrauch nicht von Weihrauchopfer unterschieden wird; es ist daher ebenfalls erst angesichts der Erfahrungen bei den Christenverfolgungen zu verstehen.
Vor dem zweiten Jahrhundert allerdings spielte dieses Zwangsopfer vor dem Bild des Kaisers noch keine Rolle. Wie stand die Urkirche zum Weihrauch?
In der himmlischen Liturgie, die den Prolog der großen Vision der Apokalypse bildet (4-5), halten die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Priester «je eine Kithara und Schalen voller Weihrauch» in Händen, «die die Gebete der Heiligen sind» (5, 8).
Diese Bedeutung des Weihrauchs weist auf den 140. Psalm (v. 2) und damit auf das Weihrauchopfer des Tempeldienstes (Ex. 30, 8). Der Vergleich mit dem Tempel wird bekräftigt durch die sieben Leuchten (4, 5 ∼ Ex. 25, 31-40) und das «Meer» (4, 6 ∼ III. Reg. 7, 23) – Berührungsangst zum jüdischen Opferdienst kennt also die Apokalypse noch nicht.
Nur: wieso «Schalen voller Weihrauch»? Im Tempel wurde das Rauchopfer auf einem vergoldeten Altar dargebracht (Ex. 30, 1-3 ∼ Apok. 8, 3) und nicht in Schalen, die man mit einer Hand tragen konnte.
Die Synagoge kennt keine Weihrauchdarbringung; und die Geräte heidnischer Tempel hat Johannes sicher nicht zum Vorbild genommen. Also: woher die Schalen?
Es können nur Weihrauchschalen des privaten Haushalts Vorbild gewesen sein; im Altertum wurde Weihrauch ganz selbstverständlich auch hier verwendet.
Die frühe christliche Liturgie fand in Räumen von Privathäusern statt. Angesichts dessen aber muß man davon ausgehen, daß genauso selbstverständlich wie Lampen oder Kerzen in der Liturgie auch Weihrauch angezündet werden konnte, ohne daß dem eine weitere Bedeutung beigemessen wurde als die, durch seinen Wohlgeruch angenehm zu sein und Insekten zu vertreiben. In der Apokalypse aber erscheint nun der Gedanke an eine geistliche Bedeutung des Weihrauchs – ein Gedanke, dessen Lebenskraft durch die Christenverfolgungen dann für lange Zeit unterdrückt wurde.
– Eis tèn tês timês tês toû Didymou Oikodomesin –
Neben den bekannten heiligen Zahlen wie Drei, Sieben, Acht, Zwölf und Fünfzig ist es nicht leicht, die besondere Bedeutung der Vierzig zu erkennen. Manches läßt an Buße denken: vierzig Tage Regen für die Sintflut, vierzig Jahre in der Wüste, vierzig Tage Fasten.
Aber schon die vierzig Tage von der Auferstehung zur Himmelfahrt zeigen, daß Buße nicht der eigentliche Inhalt sein kann. Jedoch machen diese Beispiele deutlich, daß es bei Vierzig vor allem um die Zeitdauer geht.
Das ist der Schlüssel: vierzig Tage dauerte es, Wasser einzulassen für die große Säuberung (Gen. 7, 4. 12. 17); vierzig Tage zur Erholung braucht die Frau nach der Geburt ihres Sohnes (Lev. 12, 2-4); vierzig Jahre dauerte es in der Wüste, bis die Schuld abgebüßt war (Num. 14, 33 f.); als Goliath vierzig Tage lang vorgesprochen hatte, war David bereit, die Sache zu erledigen (I. Sam. 17, 16); nach vierzig Tage hatte Elias den Horeb erreicht (III. Reg. 19, 8); nach vierzig Tagen hatte Christus sein Fasten vollendet (Mtth. 4, 2; Lc. 4, 1 f.). Und: vierzig Tage lang empfing Moses auf dem Sinai die Offenbarung (Ex.24, 18); vierzig Tage lang erschien der Auferstandene seinen Jüngern (Act. 1, 3).
Vierzig ist also die Zahl der Vollendung: das Werk ist vollbracht, das Ziel erreicht, die Buße vollendet, die Offenbarung abgeschlossen.
Dem entsprechen vierzig Jahre als Alter der Reife: mit vierzig Jahren heiratete Isaak Rebekka (Gen. 25, 20), mit vierzig Jahren heiratete Esau (Gen. 26, 34); mit vierzig Jahren hatte Moses sein Studium abgeschlossen und konnte sich nun daranmachen, nach seinen Brüdern, den Israëliten zu sehen (Act. 7, 23); als Kaleb vierzig Jahre alt war, sandte Moses ihn aus (Jos. 14, 7).
Eine weitere Nuance von Vierzig ist wohl vom Gedanken der Vollendung angeregt:
Vierzig Jahre lang regierten die Richter Othoniel (Jud. 3, 11), Gedeon (8, 28), Heli (I. Sam 4, 18) und wohl auch Debbora (Jud. 5, 31), ebenso die Könige David (II. Sam. 5, 4; III. Reg. 2, 11; I. Par. 29, 27), Salomon (III. Reg. 11, 42; II. Par. 9, 30) und Joas (II. Par. 24, 1).
Vierzig ist also auch die Zahl der Herrschaft.
1 Die Didaché dürfte aus apostolischer Zeit stammen. Klaus Berger (Das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Frankfurt 1999, S. 302) datiert sie in die frühen sechziger Jahre.
• Orietur Occidens •
Wilfried Hasselberg-Weyandt
Namen und Wörter der Bibel
Namen
Im Neuen Testament werden für die Apostel an verschiedenen Stellen unterschiedliche Namen genannt, so daß man fragen mag, ob es sich um denselben Apostel handelt.
Überhaupt erscheinen im Neuen Testament Personen, die zwei Namen tragen; um die Frage zu beantworten, gilt es, diese Fälle zu betrachten.
In zweierlei Fällen liegt die Antwort auf der Hand:
(1.) Jesus selber hat Simon Barjona den Namen Kephas gegeben, auf Griechisch Petrus (Matth. 16, 18).
Didymos (11, 16; 21, 2) ist ebenso das griechische Wort für Thomas, Zwilling, kein zweiter Name
1.
(2.) Semitischer und griechischer Brauch war es, dem Namen eines Mannes den seines Vaters, das Patronymikon, hinzuzufügen, im Hebräischen mit «ben», im Aramäischen mit «bar», im Griechischen einfach im Genitiv. Griechische Patronymika pflegen mit «Sohn des ...» übersetzt zu werden; da sind Levi, der Sohn des Alphäus (Marc. 2, 14) und in den Apostellisten (Matth. 10, 2-4; Marc. 3, 16-19; Luc. 6, 14-16; Act. 1, 13) Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus sowie Judas, der Sohn des Jakobus.
Betrachtet man westlicher Tradition gemäß die Apostel Jakobus und Judas als die „Herrenbrüder“ dieses Namens (Matth. 13, 55; Marc. 6, 3; ersterer auch Matt. 27, 56; Marc. 15, 40), so könnte bei Judas mit dem Genitiv vereinfachend der ältere Bruder genannt sein (vgl. Jud. 1, 1).
So kommt es zu den Namen «Simon Barjona» (Matth. 16, 17; im syrischen Text auch Joh. 21 15-17), Joseph Barsabbas (Act. 1, 23), Joseph Barnabas (Act. 4, 36) und Judas Barsabbas (Act. 15, 22).
Im Johannes-Evangelium (1, 45-50) ist ausführlich die Berufung eines Jüngers geschildert, der in den Apostellisten nicht erscheint: Nathanael. Dort aber ist ein Apostel nur mit solch einem Patronymikon bezeichnet: Bartholomäus. Es ist anzunehmen, daß er Nathanael ist; im Johannes-Evangelium ist seine Berufung mit Philippus verbunden, in den Apostellisten der Evangelien wird er mit diesem zusammen angeführt.
Beiseite bleiben hier Personen, die nur einmal und nur mit Patronymikon erwähnt werden.
In anderen Fällen ist die Antwort weniger offensichtlich:
(3.) Saulus wurde auch und bald nur noch Paulus genannt (Act. 13, 9). Er war römischer Bürger; es wird angenommen, daß sein Vater als Freigelassener eines Paullus dessen Namen erhalten hat.
Daß Paulus’ Eltern von den Römern gefangengenommen worden waren, bestätigt Hieronymus (Liber de viris inlustribus. Cap. V). Er nimmt allerdings an, daß Paulus diesen Namen dem Prokonsul L. Sergius Paullus zu Ehren angenommen habe, da sein Name Paulus nach seiner Begegnung mit ihm (Act. 13, 7) zum ersten Mal genannt wird.
Zwei andere lateinische Namen erscheinen als Zweitnamen, das Pränomen Marcus für einen Johannes (Act. 12, 12), wohl den Evangelisten Marcus, und Justus für Joseph Barsabbas und für einen Jesus (Col. 4, 11). Ebenfalls römische Bürger? – hier könnte man nur raten.
(4.) In anderen Fällen gibt es keinen solchen Grund. Es verbleiben in den Apostellisten Simon, der Zelot oder Kananäer – das griechische und das gräzisierte aramäische Wort bedeuten beide «Eiferer» – und Judas Iskarioth und an anderer Stelle Jakobus «der Kleine» (Marc. 15, 40).
Sodann erscheint bei Matthäus und Markus der Apostel Thaddäus, bei Lukas aber (in Evangelium und Apostelgeschichte) Judas, (der Sohn) des Jakobus, der auch im Johannes-Evangelium vorkommt (14, 22). Zwei Namen also desselben Apostels? Und der Zöllner, den Jesus beruft, ist dem Matthäus-Evangelium (9, 9) zufolge Matthäus, der dann in allen Apostellisten erscheint; in anderen Evangelien aber heißt er Levi (Marc. 2, 14; Luc. 5, 27). Wieder zwei Namen desselben Apostels? Oder wäre dieser Zöllner gar nicht der Apostel?
Letzteres ist unwahrscheinlich: Solch eine Berufungsgeschichte, die in drei Evangelien erzählt wird, bezieht sich nicht auf eine nebensächliche Gestalt (man vergleiche die Geschichte der Berufung des Matthäus mit der der Bekehrung des Zacchäus (Luc. 19, 1-10)).
Es sind bei beiden jeweils zwei Namen für denselben Apostel. Warum?
Einige Namen von Patriarchen und Stammvätern waren äußerst beliebte Namen; darum war es sinnvoll, den Trägern solcher Namen noch einen Beinamen zu geben. All die Apostel, die zwei Namen führen, haben einen solchen Namen, und ebenso Petrus sowie alle, ausgenommen wohl Nathanael, die mit einem Patronymikon bezeichnet werden.
Es lohnt immer wieder, in der Bibel tiefere Bedeutungen der Worte zu suchen. Manchmal aber findet man welche, die es gar nicht gibt.
Kýrios
«Hymeîs phoneîté me Ho didáskalos kaì Ho kýrios, kaì kalôs légete, eimì gár – Ihr nennt mich „Der Meister“ und „Der Herr“, und ihr sagt es richtig, denn ich bin es» (Joh. 13 13).
Als kýrios wird Jesus im Neuen Testament immer wieder bezeichnet – als Johannes zu Petrus sagte: «Ho kýriós estin – es ist der Herr» (Joh. 21 7), war es klar, daß es Jesus war.
«Kýrios», so wird gesagt, bezeichne im Neuen Testament vor allem Jesus in seiner Göttlichkeit oder seiner geistlichen Vollmacht.
Nun kennt das Griechische für »Herr» zwei Wörter, «kýrios» und «despótes» («ánax» war nicht mehr gebräuchlich). Beide werden im Neuen Testament verwendet, «despótes» aber nur selten, insgesamt nur neunmal. Doch beide werden sowohl für Gott, den Vater verwendet – «kýrios» etwa in Luc. 2, 9, «despótes» etwa in Luc. 2, 29 – als auch für Jesus Christus – «despótes» in II Petr. 2, 1 – als auch für weltliche Herren – bei der Ermahnung, diesen untertan zu sein, spricht etwa Eph. 6, 5 von «kyríois», I Petr. 2, 2, 18 von «despótais».
Doch Jesus und seine Apostel sprachen miteinander aramäisch; die beiden griechischen Wörter werden unterschiedslos gebraucht, weil beide das eine aramäische Wort «mara» wiedergeben.
Im Neugriechischen ist «kýrios» das Allerweltswort für «Herr», so wie dieses deutsche Wort oder das französische «Monsieur».
Eros – agápe
Für «lieben» kennt das Griechische vier Wörter: «erân», «agapân», «phileîn» und «stérgein». Ihnen entsprechen drei Wörter für «Liebe»: «éros», «agápe» und «storgé».
Von diesen Wörtern gebraucht das Neue Testament nur die Verba «agapân» und «phileîn» sowie das Substantiv «agápe». Warum?
«Stérgein» und «storgé», zärtliche, besonders elterliche Liebe, waren wohl immer eher seltene Wörter; das Verbum «stérgein» ist im Neugriechischen ausgestorben. «Erân» und «éros» hatten eine sexuell gefärbte Bedeutung; Eros war der heidnische Gott der körperlichen Liebe. Aber das war nicht der einzige Grund, diese Begriffe zu meiden: in manchen Formen überschneidet sich «erân» mit «ereîn», dem Futur von «sagen» – «erô» etwa kann gleichermaßen «ich liebe» und «ich werde sagen, sprechen» bedeuten. Auch dieses Wort ist im Neugriechischen ausgestorben; es gab es in der Umgangssprache wohl schon in der Zeit des Neuen Testaments nicht mehr.
So bleiben also nur «agapân» und «phileîn» für «lieben» und «agápe» für «Liebe»; das Substantiv «philía» bedeutet «Freundschaft».
Diese beiden Verba aber werden völlig unterschiedslos gebraucht. Im Johannes-Evangelium (21 15-17) fragt Jesus Petrus zweimal «agapâs me?» und Petrus antwortet jeweils «philô se» Darauf fragt Jesus «das dritte Mal»: «phileîs me?» Wenn auch der lateinische Text konsequent «agapân» mit «diligere», «phileîn» mit «amare» überträgt, so muß es im wirklichen aramäischen Wortwechsel immer das gleiche Wort gewesen sein – sonst stimmte die Formulierung nicht: er «sagte ihm das dritte Mal: Simon, (Sohn) des Johannes, phileîs me?» –, «racham» nämlich, wie auch im syrischen Text («r’chem»).
Doch die Bedeutung von «phileîn» begann sich bereits zu wandeln: in den Perikopen um den Verrat des Judas Iskariot (Matth. 26, 48; Marc. 14, 44; Luc. 22, 47) heißt es «küssen»; im Neugriechischen hat es nur noch diese Bedeutung.
Ekklesía
«Sỳ eî Pétros, kaì epì taúte tê pétra oikodoméso mou tèn ekklesían – Du bist Petrus / der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen» (Matth. 16 18).
«Ekkaleîn» heißt «herausrufen», darum bezeichne «ekklesía» die «Herausgerufenen», so ist zu hören.
Doch in der griechischen Antike hatte «ekklesía» eine besondere politische Bedeutung angenommen; sie bezeichnete eine Institution, die offizielle Volks- oder auch die Heeresversammlung, umfaßte alle stimmberechtigten oder wehrfähigen Bürger.
Im Neuen Testament aber ist dieser Begriff nicht zu trennen von seinem Gebrauch im Alten Testament. In der Septuaginta gibt das Wort das hebräische «qahal» und «maqhel» wieder, die eine ähnliche Bedeutung haben, besonders aber die Versammlung der Gemeinde bezeichnen, in der Gott gepriesen wird – Martin Buber übersetzt «qahal» mit «Versammlung», «maqhel» aber mit «Weiheversammlung».
Den biblischen Begriff auf «herausrufen» zurückzuführen trägt zum Verständnis nichts bei.
Das Wort «ekklesía» wurde im Lateinischen als Fremdwort und in der Folge in den romanischen Sprachen als Lehnwort beibehalten. «Meine ekklesía» – das ist die Kirche des Herrn, die «kyriakè ekklesía»; aus dieser Bezeichnung entstanden das deutsche Wort «Kirche» und die verwandten Wörtern in den germanischen und slawischen Sprachen.
Ho ponerós – tò ponerón
«Allà rŷsai hemâs apò toû – sondern erlöse uns vom Bösen» (Matth. 6 13).
«Ponerós» heißt «böse». Nur: was ist im Vater unser gemeint, «tò ponerón – das Böse» oder «ho ponerós – der Böse»?
Sprachlich ist im Griechischen ebenso wie im Lateinischen und im Deutschen beides möglich. Aber, so wird gesagt, dem Sprachgebrauch im neuen Testament zufolge bedeute dieses Wort in der Regel «den Bösen», den Teufel nämlich.
Dieser Satz steht im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt. Die erste Stelle im Neuen Testament, in der dieses Wort erscheint, ebenfalls in der Bergpredigt, ist der Abschlußvers der Seligpreisungen (Matth. 5 11): «Makárioí este hótan oneidísosin hymâs kaì dióxosin kaì eíposin pân poneròn kath’ hymôn pseudómenoi héneken – Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch über euch sagen um meinetwegen.» Hier ist eindeutig das Neutrum gemeint, «Böses». Sicher bezeichnet das Wort an anderen Stellen «den Bösen»; doch das heißt, die Bedeutung dieses Worts im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, ist nicht eindeutig zu bestimmen.
Krampf aber ist es, «den Bösen» als Bedeutung an dieser Stelle vorauszusetzen und darum «von dem Bösen» statt «vom Bösen» – beide Formulierungen stehen unterschiedslos für das Maskulinum und das Neutrum, nur hat im ersteren Fall «dem» demonstrativen Charakter, während bei «vom» die Präposition mit dem einfachen Artikel zusammengezogen ist.
• Orietur Occidens •
Wilfried Hasselberg-Weyandt
Der Sohn Gottes – Sohn der Jungfrau
– Sohn Davids
Anmerkungen zur Familie Jesu
Sohn der Jungfrau – Sohn Davids
Die Stammbäume Jesu bei Matthäus (1, 1-16) und Lukas (3, 23-31) zeigen seine Abstammung von David, heben sie hervor (Mtth. 1, 17), von hilfesuchenden Kranken wird er immer wieder als Sohn Davids angesprochen (Mtth. 9, 27; 15, 22; 20, 30 f.; Mk. 10, 47 f.; Lk. 18, 38 f.), beim Einzug in Jerusalem wird er als Sohn Davids gefeiert (Mtth. 21, 9; vgl. Mk. 11, 10) – daß er Sohn Davids war, steht für Evangelisten und das ganze Volk außer Frage.
Doch ebenso selbstverständlich erscheint er in den Schriften des Neuen Testamentes als Sohn Gottes, von der Jungfrau geboren; und er selber relativiert seine Abstammung von David (Mtth. 22, 43-45; Mk. 12, 35-37; Lk. 20, 41-44).
Als Sohn der Jungfrau ist er physisch nicht der Sohn Josephs. Seine Abstammung von David aber ist darin begründet, daß Joseph, der von David abstammt, sein Vater ist.
Daß auch Maria vom Stamme David sei, wird weder von den ältesten Quellen erwähnt noch würde dies allein dazu berechtigen, Jesus Sohn Davids zu nennen – die Abstammung wurde in Israel patrilinear gerechnet.
Sohn Gottes, von der Jungfrau geboren, und Sohn Davids durch seinen Vater Joseph – wie ist das vereinbar?
S. Julius Africanus, von Eusebius in seiner Kirchengeschichte (H. E.) zitiert, gibt – in einem anderen Zusammenhang – die Antwort: «Da nämlich die Namen der Geschlechter in Israel entweder physisch oder gesetzlich aufgezählt wurden ...» (I, 7, 2) – gesetzlich: er meint hiermit das Levirat. Wenn auch das Levirat etwas völlig anderes ist als die Jungfrauengeburt, so zeigt es doch deutlich das Wesen der gesetzlichen Vaterschaft, die nicht die physische voraussetzt.
«Wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu haben, dann nehme die Frau des Verstorbenen nicht von außerhalb einen fremden Mann; ihr Schwager komme zu ihr und nehme sie sich zur Frau und gehe das Levirat mit ihr ein. Und es geschehe, daß der Erstgeborene, den sie gebiert, sich auf den Namen seines Bruders stelle, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel.» So ordnet es die Thora an (Deut. 25, 5 f.). «Sich auf den Namen seines Bruders stellen», das heißt, daß das Kind gesetzlich das Kind des Verstorbenen ist.
Zweimal ist im Alten Testament ein Levirat zu finden, und jeweils bei Vorfahren des Herrn.
Zwei Kapitel des Buches Ruth (3 f.) handeln davon, wie Booz (Boas) das Levirat mit Ruth übernimmt.
Immer wieder wird Zorobabel (Serubabel) als Sohn Salathiels (Sealthiels) bezeichnet (Ezr. 3, 2; Neh. 12, 1; Hagg. 1, 1.12.14; 2,3.23; Lk. 3, 27); bei Matthäus (1, 12) steht sogar ausdrücklich: « Salathiel aber zeugte Zorobabel.» Im I. Buch der Chronik jedoch (3, 17-19) erscheinen keine Söhne Salathiels, Zorobabel aber steht hier als ältester Sohn Phadaias, eines Bruders von Salathiel: es ist anzunehmen, daß hier Phadaia durch Levirat für den verstorbenen Salathiel Zorobabel gezeugt hat.
Gesetzlich kann also ein Kind Sohn eines Mannes sein, das in seinem Namen mit seiner Ehefrau von seinem Bruder gezeugt wurde; wesentlich ist: mit seiner Ehefrau. Wenn das nun ein Bruder kann, so kann erst recht Gott einem Mann durch dessen Frau einen Sohn schaffen. Dem Gesetz nach ist Jesus Sohn Josephs und damit Sohn Davids.
«.. über seinen Sohn, der Ihm geboren ist aus den Samen Davids dem Fleische nach» – diese Formulierung des heiligen Paulus (R. 1, 3) ist für den modernen Leser verwirrend. Doch diese Ausdrücke haben nichts mit leiblicher Verwandtschaft zu tun.
Samen: Das hebräische Wort zera‘ bezeichnet nicht nur Pflanzensamen und männlichen Samen, sondern auch das Geschlecht, den Stamm und, Gesenius’ Handwörterbuch zufolge, im übertragenen Sinne auch Gruppen von Menschen, die nicht verwandt sind (Jes. 1, 4 und Prov. 11, 21 sind dort angeführt).
Dem Fleische nach: Dieser Ausdruck bedeutet „nach weltlicher Ordnung“. Josef Blinzler zeigt das auf an Beispielen wie „Weise dem Fleische nach“ (I. Kor. 1, 26) und „Herren dem Fleische nach“ (Eph. 6, 5; Kol. 3, 22) (S. 108 ff.).
Wo leibliche Abstammung gemeint ist, gebraucht Africanus das Wort „phýsei – der Natur nach“; „verwandt“ im leiblichen Sinne heißt bei ihm „gnésios“.
Die Stammbäume des Herrn
Das Anliegen des Africanus im oben angeführten Text ist, den Unterschied zwischen den Stammbäumen des Herrn bei Matthäus und bei Lukas zu erklären. Ihm zufolge waren die beiden dort genannten Großväter Brüder mütterlicherseits, ihre Mutter Estha war zuerst mit Matthan und nach dessen Tod dann mit Melchi verheiratet. Als Melchis Sohn Heli kinderlos gestorben war, zeugte sein Bruder Jakob, der Sohn Matthans, durch Levirat für ihn Joseph, den Vater Jesu. Da Matthan ebenso wie Melchi und damit Jakob ebenso wie Heli von David abstammten, war auch Joseph auf jeden Fall Sohn Davids.
Was allerdings Africanus nicht beachtet, ist, daß Matthan und Melchi nicht nur von David, sondern beide auch von Zorobabel abstammten. Für Zorobabels Vater Salathiel aber gibt Matthäus (1, 6-12) dieselbe Stammlinie an wie das I. Buch der Chronik (3, 5-18), Lukas jedoch (3, 27-31) eine völlig andere, was unerklärt bleibt.
Maria – immer Jungfrau
„Aeipárthenos – immer Jungfrau“: dieser Titel der heiligen Maria erscheint in der Forma longior des Glaubensbekenntnisses des heiligen Epiphanius von Salamis von 374 (D 13 / DS 44). Für die ganze Kirche verbindlich wurde er 553 durch das II. Constantinopolitanum (de tribus Capitulis, anath. 2 [D 214 / DS 422]). Doch die Lehre von ihrer immerwährenden Jungfräulichkeit gab es bereits im zweiten Jahrhundert (vgl. Blinzler S. 134); und auch die Reformatoren hielten daran fest (l.c. 136 f.). Erst viel später wurde sie immer mehr in Zweifel gezogen; und es drängt sich der Verdacht auf, daß diese Zweifel ihren Nährboden in Zweifeln an der Jungfrauengeburt haben.
Zur Begründung dieser Lehre führt Josef Blinzler (S. 55 f.) Hieronymus an (adv. Helvid. 6-8). Grundzüge seiner Argumentation seien hier für den modernen Leser aufbereitet.
Wenn man von der Jungfrauengeburt ausgeht: Was wußten Maria und Joseph von Jesus? Sicher noch nichts von seiner Göttlichkeit, von der Dreifaltigkeit; die begann man erst seit seinem öffentlichen Auftreten ganz langsam zu erfassen.
Aber sie wußten, daß das Kind nicht menschlich gezeugt war, sondern von Gott, vom Heiligen Geist stammte (Mtth. 1, 20; Lk. 1, 35). So mußte Joseph Marias Leib als heilig ansehen, und vor allem, was Gott heilig war, hatte man in Israel größte Ehrfurcht – im Alten Testament war der mit dem Tode bestraft worden, der, wenn auch mit guter Absicht, es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren (II. Sam. 6, 6 f.).
Die Brüder des Herrn
An etlichen Stellen der Evangelien und auch in der Apostelgeschichte und in Paulusbriefen ist von Brüdern und auch Schwestern Jesu die Rede; vier Namen von Brüdern werden genannt: Jacobus und Joses, Judas und Simon (Mtth. 13,55; Mk. 6,3), drei von ihnen werden auch von Hegesippus genannt (s.u.), Jacobus wird zudem an einer Stelle der Jüdischen Altertümer des Josephus erwähnt (XX. 9, 1 / [200]). In der Urkirche wurden diese Brüder und Schwestern des Herrn niemals als Kinder Marias bezeichnet, im späteren Altertum nur ausnahmsweise und erst seit dem III. Jahrhundert als solche angesehen (Blinzler S. 130 ff.). Doch in der Neuzeit hat sich diese Ansicht sehr verbreitet.
Zugrunde liegt ihr der europäische und besonders der moderne europäische Sprachgebrauch. In der Ethnologie ist es wohlbekannt, daß jede Kultur ihr eigenes System von Verwandtschaftsbezeichnungen hat; die entsprechenden Wörter werden in der Regel in einer Stammtafel dargestellt. Weltweit sehr verbreitet sind klassifikatorische Verwandtschaftsbezeichnungen, bei denen Bezeichnungen für die engsten Angehörigen ausgedehnt werden auf weitere Angehörige. Züge davon finden sich auch bei den Hebräern.
Schon daß Jesus in den Evangelien so oft als «Sohn» Davids bezeichnet wird, daß von den Juden der Zeit Jesu Abraham als ihr Vater bezeichnet wird, so im Magnificat (Lk. 1, 55) und im Benedictus (Lk. 1, 73), zeigt, daß diese Verwandtschaftsbezeichnungen in einem weiteren Sinn verstanden wurden. Das gleiche gilt für die Wörter „Bruder“ und „Schwester“.
Josef Blinzler hat über „Die Brüder und Schwestern Jesu“ ein Buch verfaßt, aus dem ich im folgenden referieren werde. Dort hat er eine beträchtliche Zahl von Stellen aus dem Alten Testament angeführt, die zeigen, daß die Wörter „Bruder“ und „Schwester“ im Hebräischen einen deutlich weiteren Bedeutungsbereich hatten als in unserer Sprache (u.a. Gen. 13, 8; 14, 14. 16; 24, 48; 29, 12. 15; 31, 23. 32. 37; Lev. 10, 4; Jos. 17, 4; I. Chr. 9, 6; 15, 5 ff.; 23, 21 f.) (S. 42 ff.). Hinzugefügt werden können zwei Stellen aus dem Buche Ruth (4, 3. 10); in diesem Buch zeigt sich zudem, daß beim Levirat nicht nur Brüder in unserem Sinn gemeint sind, sondern auch weitläufigere Verwandte in der Pflicht stehen.
Demgegenüber kennt das Hebräische für „Cousin“ oder „Cousine“ kein eigenes Wort (S. 41).
Josef Blinzler führt etliche Belege dafür an, daß die im Neuen Testament genannten Brüder Jesu keine Brüder in unserem Sinn waren, sondern Cousins, die Schwestern Cousinen:
I. Am Kreuz gibt Jesus seiner Mutter den Apostel Johannes zum Sohn (Joh. 19, 26 f.). Da ein erwachsener Mann weniger eine Mutter braucht – und nach Matthäus (27,56) die Mutter des Johannes noch lebt und dabeisteht – als eine Witwe einen Sohn, kann das nur den Grund haben, daß Jesus Marias einziger Sohn war und er nun auf diese Weise die Zukunft seiner Mutter sichert (S. 69 f.).
II. Die Evangelien berichten, daß Jesus von der Jungfrau geboren wurde und daß er der erstgeborene Sohn (Lk. 2, 7) war („der Erstgeborene“ ist ein vor dem Gesetz bedeutsamer Titel, der keineswegs besagt, daß es nachgeborene Kinder gegeben habe; S. 56 f.). Hätte Maria weitere Kinder gehabt, so könnten es also nur jüngere Kinder sein (S. 66 f.).
Zur Pascha-Wallfahrt nach Jerusalem war Maria als Frau nicht verpflichtet; dennoch zog sie mit Joseph dorthin (Lk. 2, 41-51), und sie blieben dort die ganze Festwoche hindurch (v. 43), wozu sie beide ebensowenig verpflichtet waren. Und als sie Jesus nicht fanden, kehrten sie zusammen nach Jerusalem zurück, nicht etwa Joseph allein (v. 45). Hielte man jene vier Brüder und die Schwestern für leibliche jüngere Kinder Marias, so wären das mindestens sechs Kinder, die noch lebten, als Jesus erwachsen war; angesichts der hohen Kindersterblichkeit früherer Zeiten hätte man noch mit weiteren Kindern zu rechnen, die Maria geboren hätte. Auch wenn damals, als Jesus zwölf Jahre alt war, noch nicht alle geboren gewesen wären, so wäre es bei einer solchen Schar kleiner Kinder kaum denkbar, daß Maria ohne Not das alles auf sich genommen hätte, kaum vorstellbar, wie sie das hätte bewältigen können (S. 64 f.).
III. Die Evangelien schildern, wie die Brüder Jesu ihm gegenüber eine «so freimütige, ja bevormundende Haltung» zeigen (Mtth. 12, 46-50; Mk. 3, 31-35; Lk. 8, 19-21; Joh. 7, 3-5), wie es für jüngere Brüder in Israel (Gen. 27, 29) und überhaupt in einer orientalischen Gesellschaft verpönt wäre (S. 66 f.).
Diese bisherigen Argumente schließen nicht aus, daß die Brüder und Schwestern Jesu Kinder Josephs aus erster Ehe gewesen seien. Doch auch dieser Annahme, die im christlichen Osten weitverbreitet ist, stehen die folgenden Argumente entgegen:
IV. In den Evangelien werden Frauen aufgezählt, die beim Kreuz standen (Mtth. 27, 56. 61; Mk. 15, 40. 47; Lk. 23, 49. 55; Joh. 19, 25). Unter ihnen sind «Maria, Jacobus’ (des kleinen [Mk.]) und Joses’ Mutter» (Mtth. 27, 56; Mk. 15, 40). Einige Verse später nennt Marcus sie dann einfach «Maria, die des Joses » (15, 47) und « Maria, die des Jacobus » (16, 1; ebenso Lk. 24, 10). Eine Frau statt nach ihrem Mann oder ihrem Vater nach ihren Söhnen zu bezeichnen, ist nur sinnvoll, wenn diese Söhne den Lesern bekannt sind (S. 74 f.). Daher muß dieses Brüderpaar auch anderswo im Neuen Testament zu finden sein.
Das ist in der Tat der Fall: sie erscheinen unter den Brüdern Jesu, «und zwar nebeneinander und in der gleichen Reihenfolge» (Mtth. 13, 55; Mk. 6, 3) (S. 73 ff.). Joses ist ein seltener Name; das Alte Testament kennt ihn nicht, und im Neuen Testament kommt er sonst nur noch in einem Teil der griechischen Überlieferung für Joseph Barnabas vor (Act. 4, 36), «eindeutig sekundär» (S. 76, Anm. 7). Wohl weil er so wenig gebräuchlich war, hat ihn die Vulgata und hat ihn im Matthäus-Evangelium ein Teil der griechischen Textüberlieferung durch das gebräuchliche «Joseph» ersetzt (S. 76). Die Pešitta (gleichsam die syrische Vulgata) bietet an all diesen Stellen beider Evangelien «Jose».
Die ersten zwei der in den Evangelien aufgezählten Brüder Jesu sind demnach Söhne einer anderen Maria (daß Maria, die Mutter Jesu, hier gemeint wäre, aber nur als Mutter von Jacobus und Joses bezeichnet würde, wäre abwegig; S. 73 f.).
V. Weitere Klärung bietet Hegesippus, ein Kirchenschriftsteller des II. Jahrhunderts, wohl jüdischer Herkunft, den Eusebius in seiner Kirchengeschichte des öfteren zitiert.
Hegesippus berichtet, daß Jacobus, der Bruder des Herrn, „der Gerechte“, den er als Naziräer darstellt, von den Aposteln als Bischof von Jerusalem eingesetzt wurde (II. 23, 4). An anderer Stelle wird berichtet, daß man nach seinem Martyrium «Symeon, den Sohn des Klopas, den auch die Schrift des Evangeliums erwähnt», als seinen Nachfolger einsetzte (III. 11, 1). Davon berichtete er an einer weiteren Stelle noch einmal: «Und nach dem Jacobus der Gerechte das Martyrium erlitten hatte, so wie auch der Herr, aus demselben Grund, wurde wieder der [Sohn] von einem Onkel von ihm, Symeon, der Sohn des Klopas, als Bischof eingesetzt, den alle vorgeschlagen hatten, der ein zweiter Cousin des Herrn war » (IV. 22, 4).
Nach Jacobus wurde also «wieder der [Sohn] von einem Onkel von ihm», «der ein zweiter Cousin des Herrn war», Bischof von Jerusalem. Demnach war auch Jacobus Sohn eines Onkels des Herrn, Cousin des Herrn. Doch die Ausdrucksweise des Hegesippus («ho ek theíou autoû – der von einem [nicht *dem] Onkel von ihm») spricht nicht dafür, daß Jacobus und Symeon Brüder vom selben Vater gewesen seien (S. 95 ff.).
Von Symeon berichtet Hegesippus, daß er im Alter von 120 Jahren unter Trajan das Martyrium erlitten hat. Auch wenn diese Altersangabe übertrieben sein dürfte, so zeigt das doch, daß er ein sehr hohes Alter erreicht hat. Von seinem Alter her ist es daher realistisch, ihn mit dem Herrenbruder Simon gleichzusetzen, wie Josef Blinzler es tut – Wechsel zwischen der hebräischen Namensform „Symeon“ und der griechischen „Simon“ war nicht ungewöhnlich (S. 98 f.).
Klopas, der Vater Symeons, war Hegesippus zufolge ein Bruder Josephs (III. 11, 1). Also waren Klopas und Symeon wie Joseph Davididen. Das gilt ebenso für den Herrenbruder Judas (III. 19, 1; 20, 1). Jacobus dagegen, so Hegesippus, habe das Recht gehabt, das Heiligtum des Tempels zu betreten (II. 23, 4), wäre demnach Aaronide gewesen, könnte folglich nur mütterlicherseits mit Jesus verwandt gewesen sein.
Daher nimmt Josef Blinzler an, daß Judas und Symeon Brüder im europäischen Sinne waren, ebenso wie andererseits Jacobus und Joses (S. 104 f.).
Als Frauen, die beim Kreuz stehen, nennt Johannes «seine [Jesu] Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die des Klopas, und Maria Magdalena». Der Klopas, der hier genannt wird, ist offenkundig der, den Hegesippus als Bruder Josephs und Vater Symeons bezeichnet, «den auch die Schrift des Evangeliums erwähnt». «Maria, die des Klopas,» war demnach wohl seine Frau, dürfte daher Symeons und wahrscheinlich auch Judas’ Mutter gewesen seien (S. 115 f.).
Unklar ist, ob Johannes hier von drei oder vier Frauen schreibt, ob «die Schwester seiner Mutter» diese Maria ist oder ob es sich um zwei verschiedene Frauen handelt. Im ersteren Fall kann sie angesichts des gleichen Namens kaum eine Vollschwester der Mutter des Herrn sein. Im letzteren Fall scheint es wahrscheinlich, daß diese Schwester seiner Mutter die von Matthäus und Markus genannte Mutter des Jacobus und Joses ist. Das hieße, daß Jacobus und Joses mit Jesus mütterlicherseits verwandt wären, Jacobus also tatsächlich Aaronide gewesen sein könnte (S. 111 ff.; 104 f.). Weniger wahrscheinlich ist, daß die Mutter des Jacobus und Joses die Frau des Klopas wäre – in diesem Fall wären alle vier Herrenbrüder Söhne derselben Mutter, wären auch Jacobus und Joses Davididen.
Josef Blinzler geht nicht auf die Frage ein, ob Klopas identisch ist mit dem Emmausjünger Kleopas (Lk. 24, 18). Der Name ist im Lukas-Evangelium anders geschrieben als im Johannes-Evangelium, aber Vulgata und Pešitta setzen die beiden Namen gleich. Doch daß die Brüder Jesu, darunter der Sohn oder die Söhne des Klopas, aufgezählt werden, ihr Einschreiten Jesus gegenüber geschildert wird und ihr Unglaube berichtet wird (Joh. 7, 5), ohne daß Klopas, der Bruder Josephs, der Vater zumindest eines von ihnen, dabei eine Rolle gespielt hätte oder auch nur erwähnt worden wäre, wäre nicht gut möglich gewesen, wenn Klopas in der Zeit des Auftretens Jesu noch gelebt und zu seinen Jüngern gehört hätte. Auch wäre ein Bruder Josephs sicher nicht so beiläufig – «einer mit Namen Kleopas» – erwähnt worden.
Die Familie des Herrn
in der Gesellschaft Israels
Wenn die Brüder des Herrn keine Brüder im europäischen Sinn waren, so fällt es auf, wie oft sie erwähnt werden, wie oft auch sie zusammen mit seiner Mutter genannt werden. Das zu verstehen hilft ein Blick auf die Gesellschaft des alten Israel.
Israel war eine segmentäre Gesellschaft. Was das heißt, zeigt besonders klar ein Vers aus dem Buch Josue (7, 14): das Volk war aufgeteilt in Stämme, die Stämme in Sippen, die Sippen in Häuser.
Häuser: das meint die Großfamilien (solchen Sprachgebrauch zeigt im Deutschen noch das Wort „Herrscherhaus“). Die Gesellschaft war vaterrechtlich geordnet, patrilinear – die männliche Linie bestimmte die Verwandtschaft – und patrilokal – Ehepaare zogen in der Regel ins Vaterhaus des Mannes. Die Familie bestand im idealtypischen Fall aus dem Pater familias und seiner Frau, den Söhnen und den unverheirateten Töchtern sowie den Schwiegertöchtern und Enkeln und auch noch den Frauen der männlichen Enkel und den Urenkeln (Salvato S. 6); nach dem Tod des Pater familias konnte sein ältester Sohn die Nachfolge übernehmen. Im idealtypischen Fall: natürlich wurde dieser Ordnung sehr oft durch Todesfälle und anderer Wechselfälle des Lebens gestört. Die Nöte von Witwen und Waisen sind ein häufiges Thema in der Bibel; für sie war es die einzig gute Lösung, in einem anderen Haus Unterschlupf zu finden, und dazu war die Sippe hilfreich.
Die Sippe, die Mišpacha: sie setzte sich zusammen aus mehreren solcher Großfamilien (laut Salvato acht bis zehn; S. 5), die ein Dorf oder einige benachbarte Dörfer bewohnten. Die Angehörigen waren zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet.
Das hebräische mišpacha, im deutschen bekannt durch die jiddische Form Mischpoche, wurde von Luther mit „Geschlecht“ übersetzt, ist in den guten neueren deutschen Übersetzungen mit „Sippe“ übersetzt (Martin Buber, Elberfelder, Herder, auch EÜ). Die Pešitta übersetzt es konsequent mit šarb’tha, während im Griechischen verschiedene Übersetzungen vorkommen. Die häufigste ist syngéneia, Verwandtschaft; ihre entspricht das lateinische cognatio; daneben kommt in der Vulgata auch oft familia vor.
Eine Ausnahme:
die Prophetin Anna / Hanna, Tochter Phanuels, aus dem Stamm Aser (Lk. 2, 36).
Seit der Königszeit und erst recht seit der Zeit des Exils haben sich diese Bindungen der segmentären Gesellschaft gelockert (Salvato S. 10 ff.). Von den zwölf Stämmen waren schließlich nur noch vier geblieben: Juda (Joseph und der Herr selbst), Benjamin (Paulus), Levi (Zacharias und Johannes der Täufer) und die Halbstämme Ephraim und Manasse (die Samariter). Soziale Bedeutung hatten die Stämme nicht mehr, abgesehen von der Sonderrolle der Leviten und von der Spaltung zwischen Juden und Samaritern. Statt wie das Buch Josue von Stamm, Sippe und Haus spricht Jesus von Heimat, Sippe (cognatio) und Haus (Mk. 6, 4).
Aber die Mišpachôth waren noch lebendig, auch wenn ihre Verbindung gelockert war – das verschärfte schon in der Zeit der Propheten die Not der Witwen und Waisen –, sie längst nicht mehr so regelmäßig Siedlungsgemeinschaften bildeten wie in alter Zeit. Nach der Geburt Johannes des Täufers kamen Nachbarn und Verwandte (syngeneîs, cognati) zu Elisabeth, ihr zu gratulieren (Lk. 1, 58) – die Nachbarschaft bestand hier also nicht zu allererst aus den Verwandten. Aber der Name des Kindes sollte sich nach der Mišpacha richten (Lk. 1, 61).
Angesichts dieser Bedeutung der Verwandtschaft, der Mišpacha verwundert es nicht, daß es Maria und Joseph so spät erst auffiel, daß Jesus nicht bei ihnen war (Lk. 2, 43 f.): daß er ein Stück mitgegangen wäre mit Verwandten derselben Mišpacha, wäre ganz normal gewesen.
Hieraus erklärt sich auch die Bedeutung der Brüder Jesu. Die Stellung der Frau war in Israel in der Gesellschaft der des Mannes untergeordnet; jedes Haus, also jede Familie braucht einen Mann, einen möglichst angesehenen, also nicht zu jungen Mann, der sie nach außen vertrat. Darum rechnet Josef Blinzler damit, daß sich Maria nach Josephs Tod dem Haus der nächsten erwachsenen männlichen Verwandten angeschlossen hat (49 f.) – dabei ist es unwesentlich, ob alle gemeinsam in einem Haus oder in nächster Nachbarschaft gewohnt haben.
Ebensogut aber kann es sein, daß noch zu Josephs Lebzeiten ein Familienvater von ihren nächsten Angehörigen gestorben war und dessen Familie sich Josephs Familie angeschlossen hat. Und da der Verband der Mišpacha, die eigentlich rein patrilinear war, sich schon etwas gelockert hatte, ist es möglich, daß eine Schwester Marias nach dem Tod ihres Mannes zu Josephs Familie gezogen ist – daher ist es durchaus denkbar, daß Jesus, der Davidide, Jacobus und Jose, nach Hegesippus Darstellung Aaroniden, als Brüder hatte.
Im einzelnen ist nicht mehr zu klären, wen alles das Haus Josephs wann umfaßte, welche Wechselfälle des Lebens, welche Todesfälle dazu geführt haben, daß es schließlich zwei oder wahrscheinlich drei Kernfamilien umfaßte; doch es steht außer Zweifel, daß es nach Josephs Tod nicht nur aus Maria und Jesus bestand. Und die Rolle des Pater familias hatte zur Zeit des Auftretens Jesu offenkundig Jacobus inne.
Für die Gesellschaft des damaligen Israel waren die, die der gleichen Mišpacha angehörten, Brüder und Schwestern im weiteren Sinn; Jesus aber und seine im Neuen Testament genannten Brüder und Schwestern dürften demselben Haus angehört haben, waren daher im sozialen Sinn wirkliche Geschwister.
Jacobus und die Apostel
In der lateinischen Tradition wird seit Hieronymus – der freilich selber diesen Gedanken bald wieder aufgegeben hat (Blinzler S. 142 ff.) – der Herrenbruder Jacobus, werden dann auch die Herrenbrüder Simon und Judas mit gleichnamigen Aposteln gleichgesetzt.
Josef Blinzler lehnt diese Sicht aus gutem Grund ab (S. 119 ff.): zu einer Zeit, als das Apostelkollegium längst zusammengestellt war (Mtth. 10, 1-4; Mk. 3, 13-19; Lk. 6, 12-16), treten die Brüder Jesu ihm gegenüber in einer Weise auf, die ihn dazu veranlaßt, sich von ihnen scharf zu distanzieren (Mtth. 12, 46-50; Mk. 3, 31-35; Lk. 8, 19-21); Johannes schreibt: «denn seine Brüder glaubten nicht an ihn» (Joh. 7, 5).
Dafür, daß Brüder des Herrn zu den Aposteln gehörten, sprechen nur zwei Paulus-Stellen bestätigt: im I. Korintherbrief stellt Paulus «die Brüder des Herrn» zwischen «die übrigen Apostel» und «Kephas»: «hoi loipoì apóstoloi kaì hoi adelphoì toû kyríou kaì Kephâs» (9, 5), im Galaterbrief (1, 19) schreibt er: «héteron dè tôn apostólon ouk eîdon ei mè Iákobon tòn adelphòn toû kyríou – einen anderen von den Aposteln [als Kephas] habe ich nicht gesehen außer Jacobus, den Bruder des Herrn». Hier scheint dieser Jacobus also zu den Aposteln gezählt zu sein. Die erstere erscheint wenig aussagekräftig (Blinzler S. 123), der zweiten hält Blinzler entgegen, daß „ei mé“ auch einfach „sondern“ bedeuten kann (vgl. Gal. 1, 7) (l.c. S. 121).
Doch auch eine andere Erklärung ist möglich: es kann sein, daß Jacobus, der «Bruder des Herrn, dem von Seiten der Apostel der Thron der Bischofswürde in Jerusalem anvertraut worden war» (H. E. II. 23, 1), zu dieser Zeit längst zu den Aposteln gezählt wurden, ähnlich wie Paulus und Barnabas (Apg. 14, 14).
Dieser Aufstieg der Herrenbrüder nach dem lapidaren «denn seine Brüder glaubten nicht an ihn» im Johannes-Evangelium ist auffällig. Doch er zeichnet sich schon vor Pfingsten ab, als die Herrenbrüder bereits einmütig im Gebet mit den Aposteln und Maria versammelt waren (Apg. 1, 14).
Der Schlüssel ist im I. Korintherbrief zu finden: Paulus zählt Jacobus unter denen auf, denen der Herr nach seiner Auferstehung erschienen ist; und während er sonst mehreren, den Aposteln, vielen Jüngern, zugleich erschienen ist, ist er nur dem Kephas und dem Jacobus jeweils allein erschienen (15, 5 ff.) – offenbar maß er dem Jacobus, der nicht ohne Grund im Volk einen sehr guten Ruf hatte (H. E. II. 23, 4), ähnlich wie später dem Paulus besondere Bedeutung bei. So schloß sich Jacobus den Jüngern an; und die übrigen Brüder folgten dem ältesten.
Litteratur
Josef Blinzler: Die Brüder und Schwestern Jesu. Stuttgarter Bibelstudien 21, Stuttgart 1967
Cornelia Salvato: Entstehung und Funktionsweise von Herrschaftssystemen: Altisrael. Typoskript, Münster 1984/85
• Orietur Occidens •